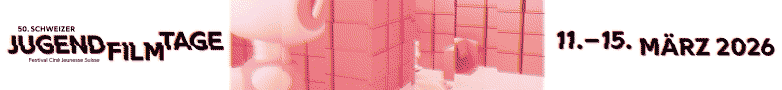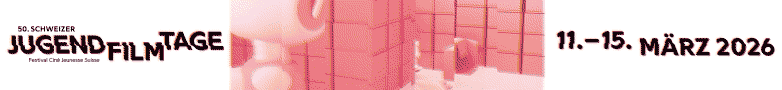Nomadland

Filmkritik von Michael Kuratli
Direkt vor Ferns altem Haus in Empire, Nevada, fängt die Wüste an. Im Haus wohnt sie längst nicht mehr, wie niemand mehr in dem Ort wohnt, der nur wegen einer Gipsplattenfirma existiert. Existierte, um genau zu sein, denn mit der Schliessung der Fabrik 2011 schloss auch Empire, und der Ort verwandelte sich in eine Geisterstadt.
Auch Fern wurde längst nach da draussen verweht, in die Wüste, lebt in ihrem Bus, zieht ihre Kreise von Campingplatz zu Campingplatz. Einmal im Jahr malocht sie eine Weile bei Amazon, zwischendurch brät sie irgendwo Burger, putzt Klos oder schaufelt Zuckerrüben in der Gegend rum. Sie macht alles, um knapp eigenständig bleiben zu können, um irgendwie über die Runden zu kommen. «Homeless» ist sie nicht, wie sie betont, ihr Van ist ihr Zuhause. Als der aber nicht mehr anspringt, muss sie dann doch ihre sesshafte Schwester um Geld anpumpen, um wenigstens die Reparatur zahlen zu können, bis sie in der nächsten Saison wieder bei Amazon anheuern kann.
Die Nomadin ist frei und doch ganz in ihren Umständen gefangen. Da nützt es auch nichts, dass ihre Schwester ihren Lebensstil mit den amerikanischen Pionier*innen vergleicht. Denn romantisch ist dieser Film nicht. Nomadland ist erfrischend unaufgeregtes Arbeiter*innenkino, wie man es in den USA selten sieht. Ken Loach und seine Milieustudien kommen in den Sinn, auch wenn Chloé Zhaos Film ganz ohne das Pathos auskommt, das man vom britischen Kollegen kennt.
Weiter zur ganzen Filmkritik auf filmbulletin.ch
Kritiken
| Verleiher |
| Walt Disney Company |