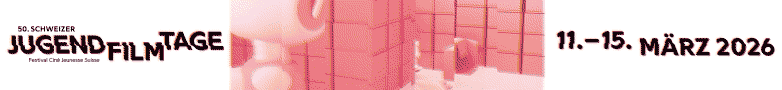Walter Gasperi über die 46. Solothurner Filmtage

Ausgesprochen vielfältig und niveauvoll präsentierte sich der Schweizer Film bei den heurigen Solothurner Filmtagen, die mit 53.000 Kinoeintritten erneut einen Besucherrekord verzeichnen konnten.
Einerseits boten die Solothurner Filmtage auch heuer wieder einen Überblick über die Produktionen des letzten Jahres. Bei den Spielfilmen spannte sich der Bogen von „Sennentuntschi“ über „Stationspiraten“ bis zu „Sommervögel“, bei den Dokumentarfilmen von „Aisheen (Still Alive in Gaza)“ über „Beyond this Place“ bis zu „Cleveland contre Wall Street“. Der mit 20.000 Schweizer Franken dotierte „Prix du Public“ ging mit „Sommervögel“ dabei ebenso an einen schon bekannten Film wie der mit 60.000 Schweizer Franken dotierte „Prix de Soleure“, mit dem Jean-Stéphane Brons „Cleveland contre Wall Street“ ausgezeichnet wurde.
Beklemmende 50er Jahre
Andererseits war man vor allem auf die Premieren brandneuer Filme gespannt. Während Christine Reponds Spielfilmdebüt „Silberwald“ über einen in rechtsradikale Kreise abdriftenden orientierungslosen Jugendlichen holzschnittartig und thesenhaft blieb, packte Pascal Verdoscis Politthriller „Manipulation“ dank Klaus Maria Brandauer und Sebastian Koch in den Hauptrollen. Die Inszenierung kommt zwar kaum über das Niveau eines soliden Fernsehfilms hinaus, sehenswert ist aber das Katz- und Mausspiel, das sich Brandauer als Bundespolizist Urs Rappold und Koch als PR-Berater Harry Wind liefern. Rappold soll in der von Angst vor Kommunismus und sowjetischer Subversion geprägten Schweiz der späten 1950er Jahre Wind als sowjetischen Spion überführen. Zunehmend muss der Polizist während des Verhörs aber erkennen, dass es gar nicht um Wahrheitsfindung geht, sondern um die Manipulation des Volkes, dessen Angst durch fiktive Geschichten geschürt werden soll, um eine Erhöhung des Militärbudgets durchsetzen zu können.
Geschichten vom Sterben
Überraschend sind bei einem Festival immer wieder Parallelen, die sich zwischen einzelnen Filmen feststellen lassen. So fand Sophie Heldmans schon angelaufener „Satte Farben vor schwarz“ fast eine Doublette in „La dernière fugue“ der seit Jahrzehnten in Quebec lebenden Léa Pool. In beiden Filmen geht es um an einer schweren Krankheit leidende Männer, die einen selbstbestimmten Tod einem langen Dahinvegetieren vorziehen. Pool konzentriert sich ganz auf zwei Familienfeste, in deren Verlauf der Sohn beschliesst seinem Vater, obwohl dieser alles andere als ein liebenswerter Mann war, zu einem Tod in Würde zu verhelfen. Geschickt hält Pool in ihrem von einem hervorragenden Schauspielerensemble getragenen Film die Balance zwischen Humor und Tragik, lässt trotz des schweren Themas keine Niedergeschlagenheit aufkommen, sondern feiert die Schönheiten des Lebens.
Ums Sterben geht es auch in Res Balzlis Dokumentarfilm „Bouton“. Balzli begleitet eine junge Puppenspielerin, die unheilbar an Krebs erkrankt ist mit der Kamera. Im Zwiegespräch mit ihrer Puppe Bouton setzt sie sich mit ihrer Krankheit auseinander. Nie kommt hier trotz der Intimität der Schilderung das Gefühl von Voyeurismus auf. Man spürt das absolute Vertrauensverhältnis zwischen dem Filmemacher und der Porträtierten. Zwischen Inszenierung und Dokumentation pendelnd entwickelt „Bouton“ große Poesie und berührt durch seinen zart-mitfühlenden Blick und das Wechselspiel zwischen den Schönheiten des Lebens und der Unabwendbarkeit des Todes.
Amerikaträume und junge Mütter
Zu den Höhepunkten der Filmtage zählte sicher auch Tobias Wyss´ „Flying Home“. Zeit seines Lebens war der Filmemacher von seinem 1939 in die USA emigrierten Onkel Walter Wyss fasziniert. Im Nachlass des 2001 auf Hawaii Verstorbenen fanden sich 25000 Fotos, die für Tobias Wyss Ausgangspunkt einer mehrjährigen Recherche war. Eindrücklich zeichnet er mit Interviews, Fotos und eigenem sehr persönlichem Kommentar das Leben seines Onkels nach, und diskutiert implizit auch ausführlich die Frage, ob denn der Onkel in Amerika das gefunden hat, was er gesucht hat. Deutlich wird da, dass sich der Traum von der Freiheit nicht erfüllte und Walter Wyss nie einen Ersatz für die Heimat gefunden hat, die er verlassen hatte, andererseits aber auch nicht mehr zurück konnte, und letztlich Zeit seines Lebens zumeist einsam blieb.
Den Blick auf ganz junge Mütter, ihre Kinder, aber auch die jungen Väter richtet dagegen Anka Schmid in „Mit dem Bauch durch die Wand“. Die Filmemacherin hat drei Teenager durch die ersten drei Lebensjahre ihrer Kinder begleitet, zeigt auf mit welchen Schwierigkeiten sie im Alltag zu kämpfen haben und wie sie im Jugendalter lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. In kurzen Szenen blickt Schmid parallel auf die drei jungen Mütter, sodass durch den permanenten Wechsel ein Schwung entsteht, der an die Unbekümmertheit der Mädchen oder auch an den Rap erinnert, mit dem sich einer der Väter beschäftigt. Wirklich nahe kommt man durch diese Sprunghaftigkeit und Kurzatmigkeit den Müttern aber kaum. Nicht dichter werden die Porträts so mit Fortdauer des Films, sondern die Frische und der Witz des Beginns verlieren sich zunehmend in Wiederholungen.
Grosse Bandbreite des Schweizer Dokumentarfilms
Trotz dieser Einwände sollte man nicht übersehen, dass gerade auch an Schmids Film die Vielfalt speziell des Schweizer Dokumentarfilms deutlich wird, der sich mit Sterben ebenso mit der Geburt, mit den Auswirkungen des Kapitalismus („Cleveland contre Wall Street“) ebenso wie mit dem Leben im Gaza Streifen („Aisheen“) und mit einem äussert skurrilen Ufologen („Mürners Universum“) ebenso wie mit Begegnungen mit Geistern („Arme Seelen“) beschäftigt. Nur die Auseinandersetzung mit der Schweizer Politik und Gesellschaft scheint im aktuellen Dokumentarfilmschaffen etwas zu kurz zu kommen.
(Walter Gasperi)